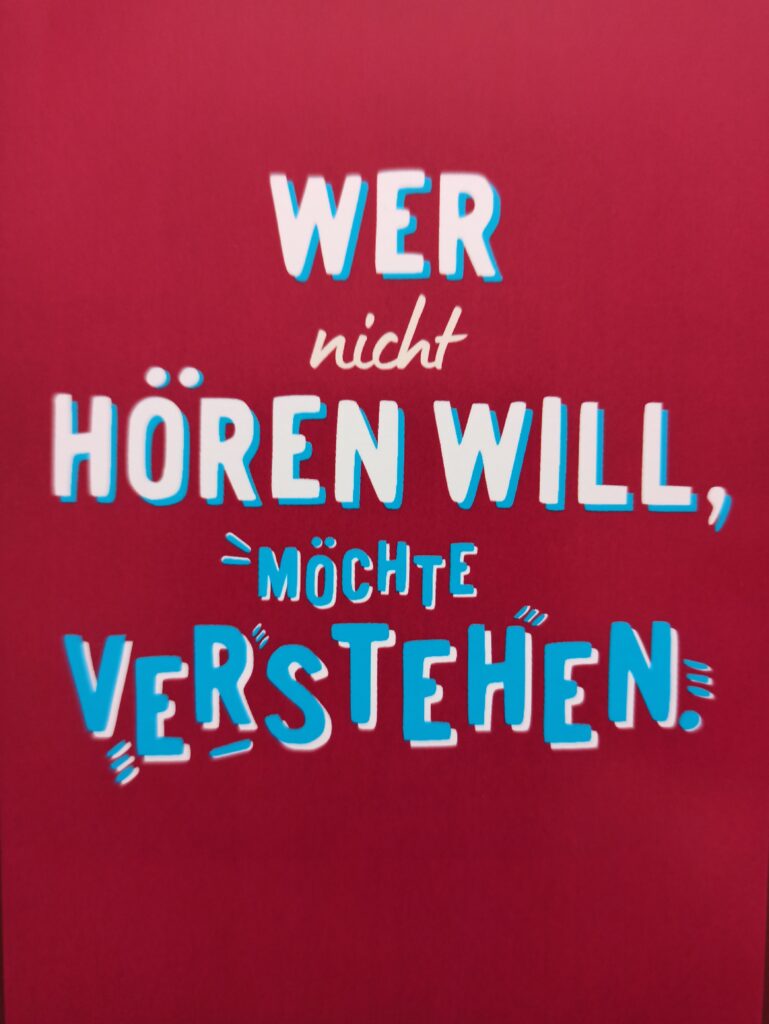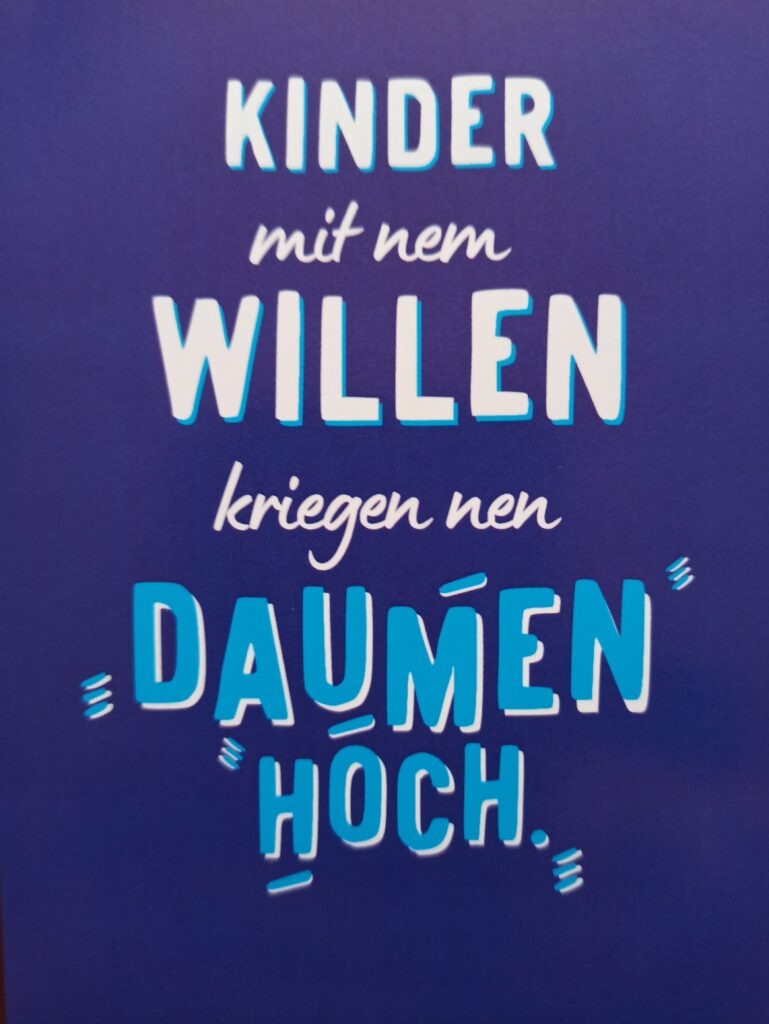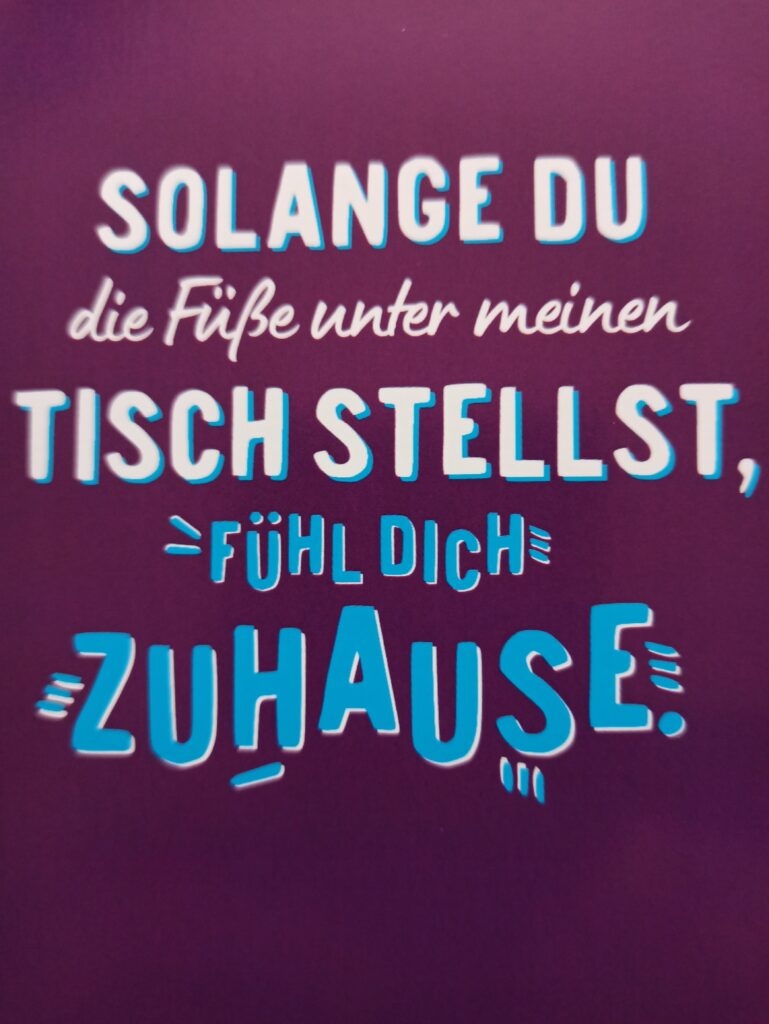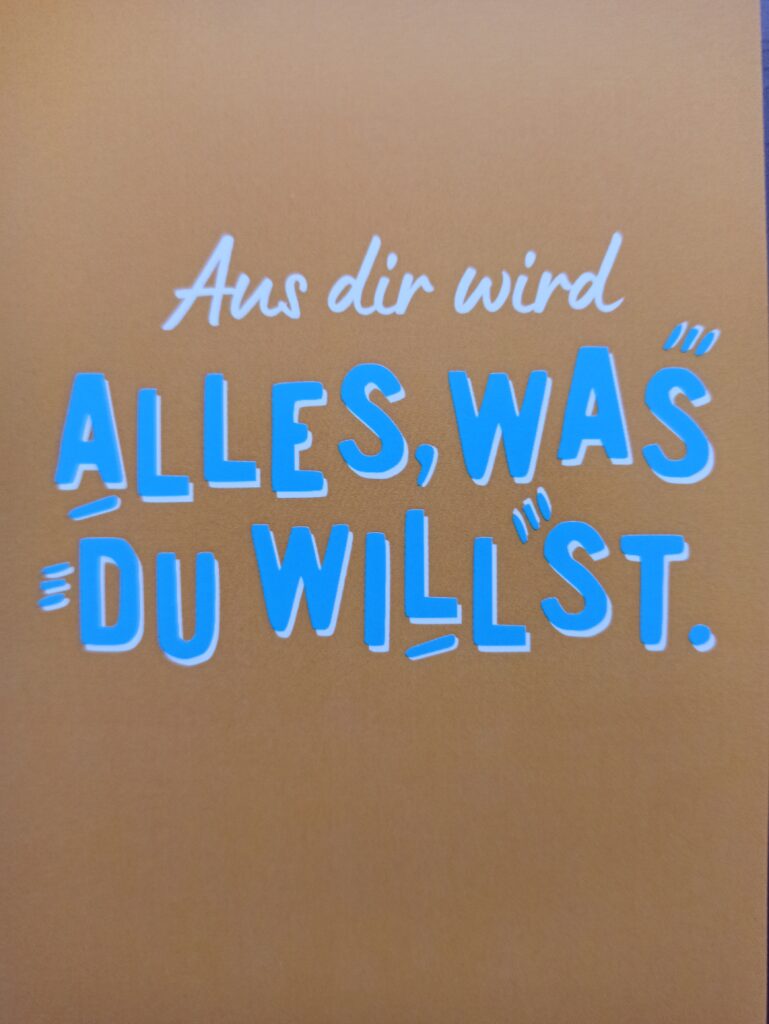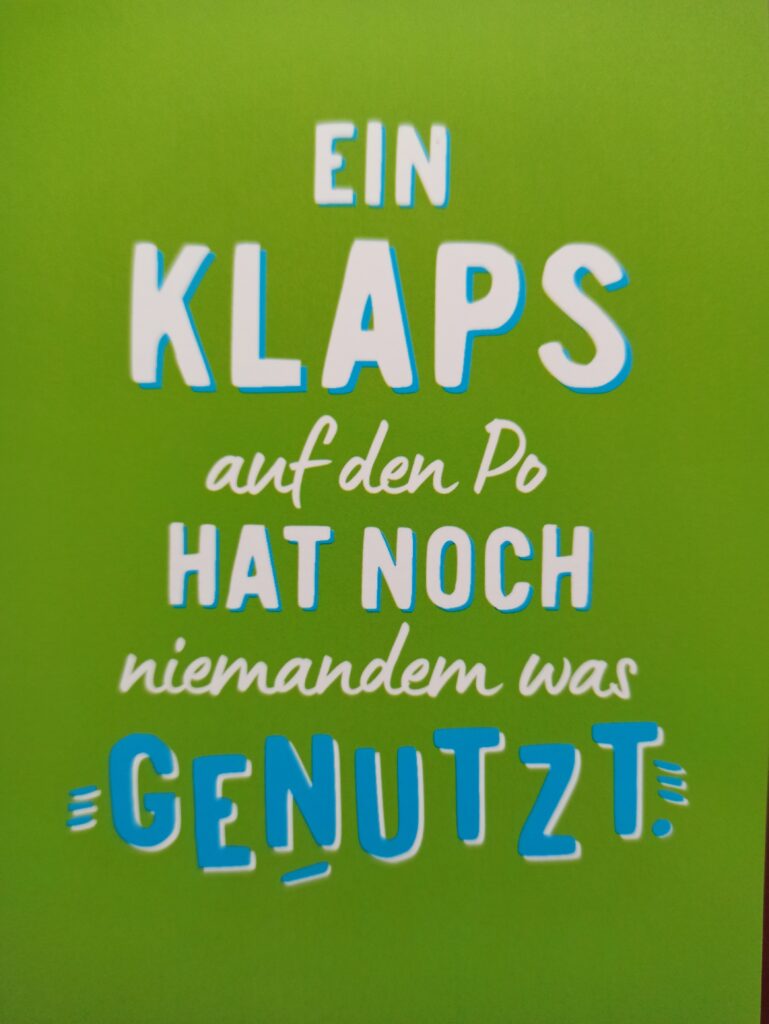Kinder und Jugendliche, die Opfer sexueller Gewalt von Eltern oder Verwandten werden, erleben dies in Deutschland häufig ähnlich, wie eine neue Studie zeigt. Man könne nicht länger von Einzelschicksalen sprechen, so die Autorinnen. Sie fordern neue Schutzkonzepte.
Werden Kinder in der eigenen Familie zu Opfern sexueller Gewalt, ist es für sie besonders schwer, ihrer Situation zu entfliehen. Das zeigt eine Studie der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs und der Goethe-Universität Frankfurt am Main, die jetzt in Berlin vorgestellt wurde.
Familien ließen sich nach außen hin abschotten und würden für viele Opfer so zur dramatischen Falle, erklärte Prof. Dr. Sabine Andresen, Vorsitzende der Kommission und Autorin der Studie. Außenstehende hätten oft Scheu, sich einzumischen oder glaubten Kindern nicht, die Erfahrungen von sexueller Gewalt in der Familie schilderten.
„Doch nicht zu intervenieren und Signale von Kindern zu übersehen, hat zu oft dazu geführt, dass Hilfe ausgeblieben ist. Wir brauchen Antworten auf die Frage, wie der Schutz von Kindern und Jugendlichen gelingen kann, ohne das Recht auf Privatsphäre von Familien zu ignorieren. Sexueller Kindesmissbrauch ist keine Privatangelegenheit“, so Andresen.
Noch wenige Erkenntnisse
Bis heute habe man vergleichsweise wenig Wissen darüber, wie Kinder und Jugendliche sexuelle Gewalt in der Familie erlebten. Deswegen sei der Einbezug von Betroffenen bei der Aufarbeitung von zentraler Bedeutung. So bildeten die Grundlage der Untersuchung 870 Betroffenenberichte, die teils in vertraulichen Anhörungen dokumentiert und teils schriftlich eingereicht und im Anschluss ausgewertet wurden.
Die Betroffenen waren zwischen 16 und 80 Jahren alt, die meisten zwischen 40 und 60. Unter den Opfern waren knapp 89 Prozent Mädchen und weibliche Jugendliche und zehn Prozent männlich. In einigen Fällen wurde das Geschlecht nicht angegeben.
Mit Abstand am häufigsten berichteten die Betroffenen den Angaben zufolge von Tätern und Täterinnen unter den Eltern (44 Prozent). Die größte Tätergruppe waren demnach Väter mit 36 Prozent von insgesamt 1 153 berichteten Fällen. Werden Pflege- und Stiefeltern hinzugezählt, machten Väter mit 48 Prozent fast die Hälfte dieser Gruppe aus.
Leibliche Mütter wurden in acht Prozent der Fälle als Täterinnen benannt, Pflege- und Stiefmütter in weiteren zwei Prozent. Als weitere Täter und Täterinnen innerhalb der Familie nannten Betroffene auch Groß- und Stiefonkel, Brüder, Großväter, andere männliche Verwandte, Stiefgroßväter, Stiefbrüder und Tanten.
Viele vergleichbare Fälle
Viele Betroffene erlebten Gewalt laut der Studie durch mehr als einen Täter innerhalb oder außerhalb der Familie. Teilweise hätten die Täter und Täterinnen voneinander gewusst, sich abgesprochen oder die sexualisierte Gewalt gemeinsam geplant und organisiert.
„Die dokumentierten Berichte betroffener Menschen offenbaren, dass es über Jahrzehnte hinweg zahlreiche vergleichbare Fälle sexuellen Kindesmissbrauchs in Familien in Deutschland gegeben hat. Dafür fehlt bisher ein öffentliches Bewusstsein“, berichtete Erziehungswissenschaftlerin Marie Demant, die ebenfalls an der Studie mitwirkte. „Die gesellschaftliche Vorstellung, es handle sich bei sexueller Gewalt in Familien um individuelle Einzelschicksale, kann somit widerlegt werden.“
Über die tatsächliche Verbreitung sexueller Gewalt gegen Kinder könne die Studie keine Auskunft geben, da nur Opfer befragt wurden, die sich freiwillig zur Teilnahme an der Untersuchung gemeldet hatten. Eine Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen von 2011 hatte ergeben, dass rund sieben Prozent der damals befragten Frauen und 1,5 Prozent der befragten Männer über Erfahrungen als Opfer berichteten. Der größte Teil der Fälle sexuellen Missbrauchs ereignete sich demnach vor dem 14. Lebensjahr und in der Familie.
Die von der Kommission angestoßene Arbeit soll tiefergehende und perspektivisch auch noch umfassendere Erkenntnisse zu sexueller Gewalt in Familien liefern. „Die Kommission hört weiterhin Berichte an und wertet schriftliche Berichte aus, die Datenbank, die für die Auswertung genutzt wurde, wird also weitergeführt“, erklärte Demant. Doch schon jetzt zeichneten sich einige Punkte ab, die vielen Fällen gemein seien. Etwa, dass Täterinnen und Täter in der Familie besonders viele Möglichkeiten hätten, Druck auf die Opfer auszuüben, um ihre Taten zu legitimieren und auch zu verhindern, dass diese öffentlich werden.
„Unsere Auswertung hat gezeigt, dass die Opfer häufig mit körperlicher Gewalt bedroht werden oder gedroht wird, anderen Familienmitgliedern wie etwa jüngeren Geschwistern etwas anzutun, um die Opfer davon abzuhalten, sich Hilfe zu suchen“, so Demant. Mit Demütigung und Abwertung werde den Opfern vermittelt, sie seien eine Belastung für die Familie.
36 Prozent der in die Studie einbezogenen Betroffenen vertrauten sich den Angaben zufolge dennoch jemandem an. Mit 19 Prozent die meisten der Mutter, sieben Prozent anderen Familienmitgliedern, fünf Prozent Gleichaltrigen oder Erwachsenen einer Institution. Nur vier Prozent wandten sich an den Vater und nur drei an Lehrerinnen und Lehrer.
Besonders die Beziehung zur Mutter sei demnach ein entscheidender Faktor dabei, ob Kinder oder Jugendliche sich offenbaren könnten. Betroffene berichteten demnach teils von Müttern, die ihnen geglaubt und geholfen hätten, aber auch über solche, die es eher als ihre Aufgabe ansahen, den Anschein der Normalität innerhalb der Familie zu wahren, als dem Opfer zu helfen.
Auch die Erfahrung mit Jugendämtern sei für die Mehrheit der Betroffenen, die Teil der Studie waren, negativ geprägt, so Demant. Den Opfern sei häufig nicht geglaubt worden, es seien keine Gespräche mit ihnen allein geführt worden, so- dass die gewaltausübenden Familienmitglieder oft Gelegenheit hatten, selbst auf die Vertreter des Jugendamtes einzuwirken, heißt es in der Untersuchung. In anderen Fällen hätten Jugendämter schlicht weggesehen, auch in solche Fällen, in denen es sichtbare Verletzungen, Videomaterial der Gewalt oder Schwangerschaften nach Vergewaltigungen gab.
Die SPD-Politikerin Angela Marquardt, die auch im Betroffenenrat beim Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) sitzt und die Studie mit vorstellte, sagte: „Alle vorhandenen Formen sexueller Gewalt finden auch in Familien statt.“ Das sei schon seit Generationen so. „Kleinkinder und Kinder sind in Familiensituationen schutzlos ausgeliefert, weil sie die Gewalt von den Menschen erfahren, auf deren Schutz sie am meisten angewiesen sind.“
Die Betroffenen hätten ein Recht auf Aufarbeitung, betonte Marquardt. „Es gibt keine nachhaltige Debatte über den Tatkontext Familie. Das muss sich dringend ändern.“ Anders als beim Sport und der Kirche gebe es keine Institution, an die sich Betroffene wenden könnten, keine festen Ansprechpartner. Die Opfer seien daher zu oft völlig allein mit ihrer Erfahrung, auch im Nachhinein werde eine Aufarbeitung durch die Familie meist nicht zugelassen.
Betroffene als Experten
„Ich hoffe, dass diese Studie der Ausgangspunkt für eine breite gesellschaftliche Debatte ist“, so Marquardt. Dabei sollten die Betroffenen, die sich einbringen wollten, nicht nur über ihre Geschichte als Opfer definiert, sondern als Expertinnen und Experten wahrgenommen werden, die einen wichtigen Beitrag dazu leisten könnten, neue Schutzkonzepte zu entwickeln, fordert Marquardt. In einem Anfang des Jahres erschienenen Impulspapier fordert der Betroffenenrat unter anderem die Möglichkeit für Minderjährige, auch ohne Zustimmung der Eltern in ein Heim oder eine Wahlfamilie zu ziehen, sowie elternunabhängige Ausbildungsförderung. „Wir wollen die Debatte zu Schutzkonzepten in Familien anstoßen, um den Spagat zwischen Familie als Privatsache und gesellschaftlicher Verantwortung zu meistern“, so Marquart.
Quelle: www.aerzteblatt.de; PP 20, Ausgabe Oktober 2021