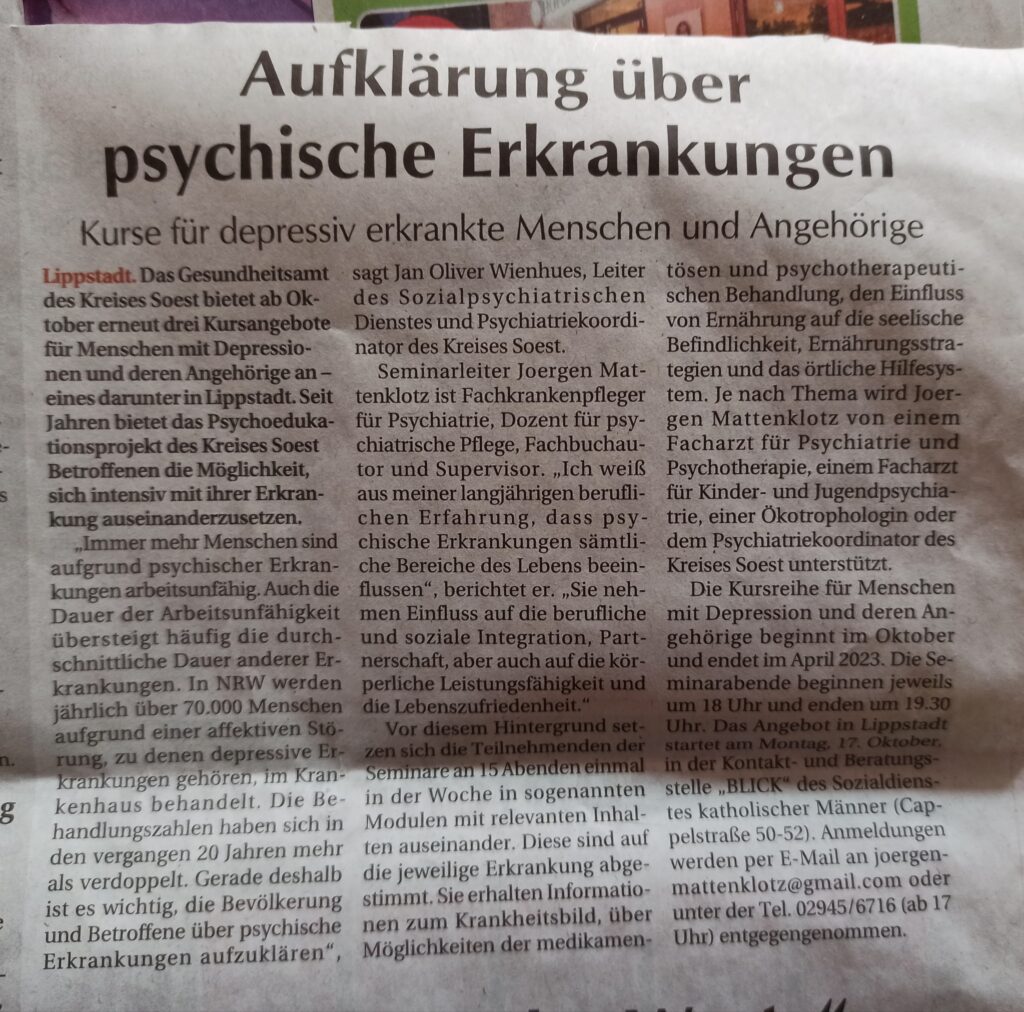Die am weitesten verbreitete Formen von Mobbing sind weder körperliche Handlungen wie Stoßen oder Treten noch verbale Drohungen oder abfällige Bemerkungen. Die am meisten verwendete Taktik ist die soziale Ausgrenzung.
Soziale Ausgrenzung bezeichnen Experten auch als „relationale Aggression“. Dieser Begriff beschreibt ein Verhalten, das die Absicht hat, die sozialen Beziehungen einer Zielperson zu beschädigen, z.B. indem hinter ihrem Rücken abwertende Bemerkungen gegenüber Dritten gemacht werden. Er beinhaltet u.a. auch, dass der Mobbende den Betroffenen von Gruppenaktivitäten ausschließt. Aktuelle Forschung unterstreicht den Schaden, der durch dieses Verhalten angerichtet wird.
„Wenn ein Kind von Gleichaltrigen in der Schule von sozialen Aktivitäten ausgeschlossen wird, sind die Folgen für dieses Kind sowohl kurzfristig als auch langfristig genauso schädlich, als wenn es jeden Tag getreten, geschupst oder geschlagen würde“, verdeutlichte Ass.-Professor Chad Rose, ein Autor der Studie von der Universität von Missouri in Kolumbien. „Diese Studie wirft also ein Licht auf die soziale Ausgrenzung, der Jugendliche oft ausgesetzt sind.“
Rose ist Direktor des Mizzou Ed Bully Prevention Lab, das darauf abzielt, Schulmobbing zu reduzieren.
In einer kürzlich in „Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth“ veröffentlichten Studie analysierten Rose und seine Kollegen eine Umfrage, die in 26 Mittel- und Oberschulen in fünf Schulbezirken im Südosten der Vereinigten Staaten durchgeführt wurde. Mehr als 14.000 Schüler wurden gefragt, ob sie Aussagen zustimmten oder nicht zustimmten, die ihre Einstellung zu Mobbing, ihre von ihnen selbst wahrgenommene Popularität und ihre Bereitschaft zu relationaler Aggression widerspiegelten.
Unter den Aussagen befanden sich u.a.:
- „Ein bisschen Hänseleien schaden niemandem.“
- „Es ist mir egal, was Kinder sagen, solange es nicht um mich geht.“
- „In meinem Freundeskreis bin ich normalerweise derjenige, der die Entscheidungen trifft.“
- „Wenn ich auf jemanden sauer bin, revanchiere ich mich, indem ich ihn nicht mehr in meine Gruppe lasse.“
„Sozial aggressive“ Kinder nehmen sich selbst oft nicht so wahr
„Kinder, die sich selbst als sozial dominant oder populär wahrnehmen, befürworten Mobbing, aber sie nehmen sich selbst nicht als sozial aggressiv wahr“, berichtete Rose über die Ergebnisse. „Es gab eine andere Gruppe, die sich selbst nicht als sozial dominant oder beliebt wahrnahm, aber sie zeigte eine eher Mobbing-freundliche Einstellung und engagierte sich für relationale Aggression.“
Also, verdeutlichte er, die erste Gruppe fand Mobbing in Ordnung, sah sich aber nicht als beteiligt an, selbst wenn sie andere tatsächlich ausgrenzte. Die zweite Gruppe, die zugab, andere zu meiden, tat dies möglicherweise, um in der sozialen Hierarchie aufzusteigen.
Unbeteiligte wirken oft – ohne es selbst zu bemerken – als Verstärker der sozialen Ausgrenzung
Eine dritte Gruppe von Umfrageteilnehmern, die weniger aggressiv handelten oder eher als Zuschauer zu bezeichnen sind, berichtete über ein geringes Maß an relationaler Aggression sowie ein geringes Maß an Mobbing-freundlichen Einstellungen.
„Das Interessante an Zuschauern ist, dass sie Mobbing oft aufrechterhalten, was bedeutet, dass sie als soziale Verstärker dienen und in der Nähe sind, wenn es passiert“, so Rose in einer Pressemitteilung der Universität.
„Wir lehren den berühmten Slogan ‚Sehen Sie etwas, sagen Sie etwas‘, aber in der Praxis ist es für Kinder schwierig, schnell einzugreifen und Konflikte einzuschätzen – selbst für Erwachsene. Wenn wir zwei Kinder in einem körperlichen Kampf sehen, fühlen wir uns verpflichtet, ihn zu beenden. Aber wenn wir beobachten, dass Kinder von Gleichaltrigen ausgeschlossen werden, scheinen Erwachsene dies nicht immer als gleichermaßen schädlich anzusehen, und das ist beängstigend „, fügte er hinzu.
Die Einbeziehung sozialer Kommunikationsfähigkeiten in den täglichen Lehrplan der Schüler sei etwas, das Lehrer laut Rose leicht umsetzen könnten. „Lehrkräfte sollten ein besonderes Lob aussprechen, wenn sie respektvolles und integratives Verhalten in der Praxis erkennen, denn die Vermittlung und Stärkung dieser Fähigkeiten ist genauso wichtig wie der Mathematik-, Naturwissenschafts- und Geschichtsunterricht.“
Nicht jedes Kind muss ein Freund sein, aber es ist wichtig, jeden mit Respekt zu behandeln. „Mobbing beginnt oder endet nicht mit den Schulglocken, es ist ein Problem unseres Zusammenlebens“, betonte Rose. „Ich denke, als Erwachsene müssen wir uns bewusster darüber sein, was wir unseren Kindern in Bezug auf unsere soziale Interaktion beibringen, da Schulen ein Spiegelbild unserer Gemeinschaften sind.“
Quelle: www.kinderaerzte-im-netz.de vom 28.10.2022