
Autor: Tanja Behde
Kurs in Lippstadt
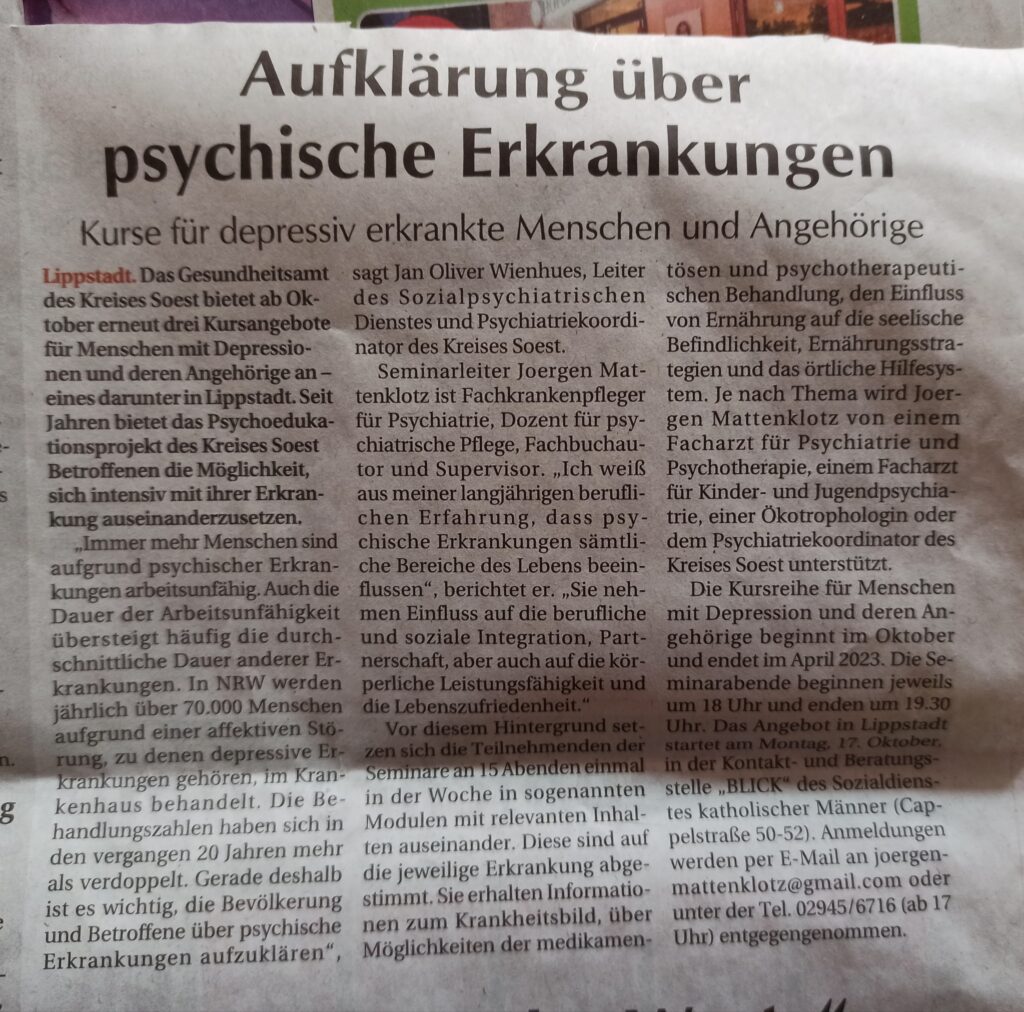
„Schmerzmanagement“ für Kinder
Beulen und blaue Flecken sind ein unvermeidlicher Teil der Kindheit. Auch wenn kein Elternteil möchte, dass sein Nachwuchs Schmerzen empfindet, kann es hilfreich sein, wenn ein Kind früh versteht, was Schmerzen sind, und mit zunehmendem Alter lernt, wie es darauf reagieren kann.
In einer Studie der University of South Australia (UniSA) haben Forscher fünf Schlüsselansätze identifiziert, die Eltern und Betreuer anwenden können, wenn sie mit kleinen Kindern über „alltägliche“ Schmerzen sprechen, und die ihre Genesung und Belastbarkeit nach einer Verletzung verbessern können.
In dieser Studie untersuchten die Forscher „alltägliche“ Schmerzen bei kleinen Kindern (im Alter von 2 bis 7 Jahren) und fragten Experten aus den Bereichen Kindergesundheit, Psychologie, Entwicklung, Belastbarkeit sowie Eltern und Erzieher, was ihrer Meinung nach die Belastbarkeit bei leichten Schmerzen oder Verletzungen sowie die Genesung bei Kindern fördern würde.
Mit 80-prozentiger Zustimmung aller Experten lauteten die wichtigsten Botschaften:
- Kinder sollten wissen, welche Funktion Schmerzen haben – Schmerz ist das Alarmsystem unseres Körpers.
- Eltern sollten den Schmerzen von Kindern Beachtung schenken – Kinder sollten sich sicher, gehört und geschützt fühlen, aber Eltern sollten daraus kein „Drama“ machen.
- Eltern sollten Kinder nach einer Verletzung beruhigen – Kinder müssen wissen, dass ihr Körper heilen wird und der Schmerz vergehen wird.
- Kinder sollten ihre Gefühle ausdrücken dürfen – dabei sollten Eltern ihnen Wege zeigen, wie sie sich selbst beruhigen können.
- Kinder sollten mithelfen, ihre Genesung zu unterstützen –z.B. indem sie die Wunde mit einem frischen Pflaster versorgen.
Die leitende Forscherin, Dr. Sarah Wallwork von UniSA, erklärte, dass Eltern und Betreuer wahrscheinlich eine entscheidende Rolle dabei spielen, wie Kindern lernen, mit Schmerzen umzugehen.
„Egal, ob es sich um einen Sturz vom Fahrrad oder den Umgang mit gefürchteten Spritzen handelt, alltägliche Schmerzerfahrungen sind eine Möglichkeit für Eltern, positive Überzeugungen und Verhaltensweisen in Bezug auf Schmerzen zu fördern“, so Dr. Wallwork.
„Obwohl es wichtig ist, Kindern beizubringen, dass Schmerz das Alarmsystem unseres Körpers ist und dass er dazu da ist, uns zu schützen, ist es ebenso wichtig zu verstehen, dass Schmerz und Verletzung nicht immer übereinstimmen.
„Als Erwachsene besteht eine der größten Herausforderungen im Schmerzmanagement darin, dass wir grundlegende, lebenslange Überzeugungen darüber haben, wie Schmerz und Genesung funktionieren. Wenn wir uns verletzen, glauben wir oft, dass Schmerzen folgen müssen; und umgekehrt, wenn wir Schmerzen empfinden, müssen wir eine Verletzung haben – aber wie die Forschung zeigt, ist dies nicht immer der Fall.
„Bei Kindern können Schmerzen durch ihre Emotionen beeinflusst werden – zum Beispiel können Angst, Hunger oder Müdigkeit die Symptome verschlimmern, obwohl es sich dabei nicht um Schmerzen handelt.
„Kindern beizubringen, dass sie eine gewisse Kontrolle über ihre Schmerzen haben – und dass ihre eigenen Gefühle diese beeinflussen können – befähigt sie, sich aktiv mit ihrer eigenen Schmerzbewältigung auseinanderzusetzen.
„Das können Kinder altersgerecht lernen. Für ein sehr junges Kind könnte das ‚Schmerzmanagement‘ darin bestehen, ein Pflaster oder ein nasses Tuch zu bekommen, den verletzten Bereich zu reiben, es abzulenken und ihm zu erklären, dass seine Verletzung durch das Pflaster geschützt ist und dass es jetzt weiterspielen kann.
„Der Schlüssel ist zu zeigen, dass das Kind [..] aktiv am Heilungsprozess beteiligt sein kann.“
„Indem wir Kindern helfen, in jungen Jahren etwas über Schmerzen zu lernen, hoffen wir, ein lebenslanges ‚hilfreiches‘ Schmerzverhalten zu fördern, das die Genesung aktiv fördert und zukünftigen Problemen vorbeugt.“
Quelle: www.kinderaerzte-im-netz.de vom 17.08.2022
Jugendliche reagieren sensibler auf Kritik der Eltern, als es den Anschein hat
Teenager erscheinen oft teilnahmslos, wenn Eltern sie kritisieren, aber sie reagieren sensibler auf die Meinung ihrer Eltern, als es den Anschein haben mag. Das jugendliche Gehirn reagiert stark auf elterliche Kritik oder Lob. Dies sind die Ergebnisse einer Studie einer interdisziplinären Forschungsgruppe von Psychologen und Neurowissenschaftlern der Universität Leiden (Niederlande).
63 Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren nahmen an der Studie teil. Während sie sich einer MRT-Untersuchung ihres Gehirns unterzogen, erhielten sie Komplimente, neutrales Feedback oder Kritik an ihrer Persönlichkeit; die Komplimente, Rückmeldungen oder Kritik schienen von ihren Eltern zu stammen. „Auf einem Bildschirm im MRT sahen sie Rückmeldungen ihrer Eltern: „Dein Vater findet dich gemein“ oder „Deine Mutter hält dich für intelligent.“ Da sowohl Eltern als auch Jugendliche zuvor Fragebögen zu diesen Persönlichkeitsmerkmalen ausgefüllt hatten, empfanden Jugendliche die Äußerungen der Eltern als realistisch, erklärte die Forscherin Lisanne van Houtum.
Missbilligung prägt sich im jugendlichen Gehirn ein
Nach jedem Lob- oder Kritikpunkt gaben die Jugendlichen ihre Stimmung an. Wenig überraschend verbesserte sich ihre Stimmung nach einem Kompliment und verschlechterte sich nach einem negativen Kommentar, insbesondere wenn diese Kritik nicht ihrem Selbstbild entsprach. Obwohl die Jugendlichen gleich viele Kritik, Lob und neutrale Kommentare von ihren „Eltern“ erhielten, fühlten sie sich nach der Feedback-Aufgabe weniger wohl in ihrer Haut. Van Houtum: „Wir glauben daher, dass Kritik von Eltern eher hängen bleibt als Komplimente.“
Die elterlichen Kommentare taten nicht nur etwas für das Selbstbewusstsein der Heranwachsenden, sondern das heranwachsende Gehirn reagierte ganz anders auf Komplimente als auf Kritik, wie die Scans zeigten. Kritik aktivierte Regionen des Gehirns, die an der Verarbeitung von Emotionen und Schmerz beteiligt sind, Regionen, die auch aktiviert werden, wenn Menschen körperlichen Schmerz erfahren. Sowohl Kritik als auch Komplimente verursachen Aktivitäten in Bereichen des Gehirns, die mit sozialer Kognition in Verbindung stehen, wie z. B. das Verstehen der Emotionen und Absichten anderer Menschen.
Jugendliche nehmen sich negative Äußerungen zu Herzen
„Was die Ergebnisse der Scans zeigen, ist, dass Kritik wirklich ‚weh zu tun‘ scheint. Bei Jugendlichen mit einem relativ positiven Selbstbild, die ihre Eltern wärmer empfinden, scheint dieser Schmerz nicht geringer zu sein. Interessanterweise haben wir nicht festgestellt, dass elterliches Lob das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert“, ergänzte die Expertin. Bisher konzentrierte sich Forschung vorwiegend auf die Auswirkungen von Peer-Feedback auf das jugendliche Gehirn und wie dies mit dem jugendlichen Selbstwertgefühl zusammenhängt. Es fehlen jedoch wissenschaftliche Daten zum Einfluss der Meinungen der Eltern auf ihre Kinder.
Die Ergebnisse werden den Forschern helfen zu verstehen, was elterliche Komplimente und Kritik mit Jugendlichen machen. Van Houtum: „Wir können Eltern die Wirkung ihrer Worte bewusst machen. Und die Erkenntnisse können bei der Gestaltung von Familientherapien und weiteren Forschungsarbeiten zu psychischen Problemen von Jugendlichen wie Depressionen helfen, bei denen ein geringes Selbstwertgefühl und die Empfindlichkeit gegenüber Ablehnung oft eine wesentliche Rolle spielen.“
Quelle: www.kinderaerzte-im-netz.de vom 29.07.2022
Frühkindliche Erfahrungen können zu irreversiblen Veränderungen des Gehirns führen
Eine durch einschneidende frühkindliche Erfahrungen veränderte Gehirnstruktur regeneriert sich nicht vollständig. Zu diesem Schluss kommt die Studie eines Forschungsteams der Universität Hamburg unter der Leitung der Psychologin und Neurowissenschaftlerin Prof. Dr. Brigitte Röder.
Frühere neurowissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass ungünstige Erfahrungen in den ersten Lebensmonaten und -jahren, wie zum Beispiel Blindheit oder Armut, die strukturelle Entwicklung des menschlichen Gehirns beeinträchtigen können. Nicht bekannt war aber bislang, ob sich die Hirnstruktur wieder erholen kann, wenn die Ursachen der Beeinträchtigungen beseitigt werden. Die neue Forschungsarbeit, deren Ergebnisse im Fachjournal „Cerebral Cortex“ veröffentlicht wurden, kommt zumindest in Bezug auf die Entwicklung der visuellen Areale des Gehirns zu einer eindeutigen Antwort: Die Gehirnstruktur bleibt nachhaltig beeinträchtigt.
3D-Modelle der Gehirne
Für die Studie hat ein Team des Arbeitsbereichs Biologische Psychologie und Neuropsychologie in Kooperation mit dem LV Prasad Eye Institute in Hyderabad (Indien) Menschen untersucht, die aufgrund von beidseitigem Grauen Star teilweise mehrere Jahre nach der Geburt blind waren und deren Augenlicht dann durch eine Operation wiederhergestellt werden konnte. Von allen Teilnehmenden, die zum Zeitpunkt der Studie zwischen sechs und 36 Jahren alt waren, wurden mit Hilfe eines Kernspintomographen Bilder des Gehirns aufgenommen, aus denen anschließend für jede Person ein 3D-Modell des Gehirns rekonstruiert wurde. In diesem Modell konnten die Forschenden messen, wie dick und wie groß die Oberfläche der Hirnrinde in den visuellen Arealen des Gehirns war.
Die Hirnrinde ist die äußerste, mehrfach gefaltete Schicht des Gehirns, die mehrere Millimeter dick ist und hauptsächlich aus Zellkörpern von Nervenzellen besteht, der so genannten grauen Substanz. Durch ihre mehrfache Faltung besitzt die Hirnrinde eine große Oberfläche und bietet viel Platz für Milliarden von Nervenzellkörpern, die für die Verarbeitung sensorischer Information und damit für die Entstehung von Wahrnehmung zuständig sind. In der normalen Entwicklung wird die Hirnrinde ab einem Alter von ein bis zwei Jahren dünner, während ihre Oberfläche bis in die Pubertät zunimmt. Beide strukturellen Veränderungen sind wichtig für die vollständige Reifung neuronaler Netzwerke.
Veränderungen der Sehrinde
Das Forschungsteam fand heraus, dass bei den vormals blinden Menschen die Sehrinde, also der Teil der Hirnrinde, in dem die Sehinformation verarbeitet wird, sowohl eine kleinere Oberfläche besaß als auch dicker war. Ihre Sehrinde ähnelte mehr der von Menschen, die seit ihrer Geburt dauerhaft blind waren als der von Menschen, die von Geburt an sehen konnten. Außerdem sagte das Ausmaß der Veränderungen in der Sehrinde vorher, wie gut die Menschen nach der Entfernung des Grauen Stars sehen lernten.
„Die Studie zeigt, dass frühkindliche Erfahrungen die Hirnstruktur langanhaltend und offenbar nicht reversibel verändern können“, erklärt Dr. Cordula Hölig, Autorin der Studie und Wissenschaftlerin an der Universität Hamburg. „Auch wenn wir hier ausschließlich den Einfluss von fehlendem Sehen untersucht haben, vermuten wir, dass auch andere extreme frühkindliche Erfahrungen, wie sie zum Beispiel bei Armut oder Vernachlässigung auftreten können, die Hirnstruktur irreversibel schädigen können.“
Quelle: www.kinderaerzte-im-netz.de vom 15.08.2022
Häusliche Gewalt in der Kindheit erhöht Risiko für psychische Erkrankungen im Erwachsenenalter
Erwachsene, die in ihrer Kindheit regelmäßig häuslicher Gewalt bei ihren Eltern und ein geringeres Maß an sozialer Unterstützung erlebt hatten, haben ein höheres Risiko, Depressionen, Angstzuständen und Sucht zu entwickeln als ihre Altersgenossen, die nicht solche Erfahrungen in ihrer Kindheit machen musste. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von kanadischen und israelischen Wissenschaftlern.
Die Studie der University of Toronto ergab, dass ein Fünftel (22,5%) der Erwachsenen, die in ihrer Kindheit regelmäßig häusliche Gewalt bei ihren Eltern sahen, irgendwann in ihrem Leben eine schwere depressive Störung entwickelten. Im Vergleich dazu waren nur 9,1% derjenigen ohne eine Vorgeschichte von elterlicher häuslicher Gewalt davon betroffen.
„Unsere Ergebnisse unterstreichen das Risiko langfristiger negativer Folgen wiederholter häuslicher Gewalt für Kinder, auch wenn die Kinder selbst nicht missbraucht werden“, verdeutlichte Autorin Professor Esme Fuller-Thomson von der University of Toronto. „Sozialarbeiter und Gesundheitsfachkräfte müssen wachsam bleiben und daran arbeiten, häusliche Gewalt zu verhindern, und sowohl die Oper von Missbrauch als auch ihre Kinder unterstützen.“
Häusliche Gewalt tritt häufig im Zusammenhang mit anderen Widrigkeiten auf, einschließlich körperlichen und sexuellen Missbrauchs in der Kindheit, was es schwierig macht, die Folgen für die psychische Gesundheit zu untersuchen, die ausschließlich mit häuslicher Gewalt bei Eltern verbunden sind, wenn kein Kindesmissbrauch vorliegt. Um dieses Problem anzugehen, schlossen die Autoren in ihrer Studie jeden aus, der in der Kindheit körperlichen oder sexuellen Missbrauch erlebt hatte. Die landesweit repräsentative Stichprobe der Studie umfasste schließlich 17.739 Befragte der Canadian Community Health Survey-Mental Health, von denen 326 angaben, mehr als 10-mal vor dem 16. Lebensjahr bei den Eltern häusliche Gewalt mit angesehen zu haben. Dies erfassten die Experten als regelmäßiges Erleben häuslicher Gewalt zwischen den Sorgeberechtigten.
Einer von sechs Erwachsenen (15,2%), die regelmäßig häusliche Gewalt beobachtet hatten, berichtete, dass er später eine Angststörung entwickelte. Nur 7,1% derjenigen, die keine elterliche Gewalt erlebten, gaben an, irgendwann in ihrem Leben auch eine Angststörung bekommen zu haben.
„Viele Kinder, die der häuslichen Gewalt ihrer Eltern ausgesetzt sind, bleiben ständig wachsam und ständig ängstlich, weil sie befürchten, dass ein Konflikt in jedem Moment zu einem Angriff eskalieren könnte. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Jahrzehnte später, wenn sie Erwachsene sind, Personen mit einer Vorgeschichte von häuslicher Gewalt bei den Eltern vermehrt Angststörungen vorkommen“, sagte Co-Autorin Deirdre Ryan-Morissette von der University of Toronto.
Mehr als ein Viertel der Erwachsenen (26,8%), die in der Kindheit regelmäßig häusliche Gewalt bei ihren Eltern beobachtet hatten, entwickelten eine Sucht, verglichen mit 19,2% derjenigen, die diesen frühen Widrigkeiten nicht ausgesetzt waren.
Es erholten sich mehr Teilnehmer von ihren negativen Erlebnissen, als die Forscher erwartet hatten
Die Ergebnisse waren nicht alle negativ. Mehr als drei von fünf Erwachsenen mit diesen negativen Kindheitserfahrungen waren in ausgezeichneter psychischer Verfassung, frei von psychischen Erkrankungen, Substanzabhängigkeit oder Selbstmordgedanken im vorangegangenen Jahr; sie waren glücklich und/oder zufrieden mit ihrem Leben und berichteten von einem hohen Maß an sozialem und psychischem Wohlbefinden, obwohl sie in der Kindheit solch erschütternden Erfahrungen ausgesetzt waren. Insgesamt war eine gute psychischen Gesundheit bei derjenigen mit negativen Erfahrungen niedriger als bei denen, deren Eltern nicht gewalttätig miteinander umgingen (62,5% gegenüber 76,1%), aber immer noch viel höher als von den Autoren erwartet.
„Wir waren positiv überrascht, dass so viele Erwachsene diese frühen Widrigkeiten überwunden haben und frei von psychischen Erkrankungen sind […]“, kommentierte Co-Autor Professor Shalhevet Attar-Schwartz von der Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare der Hebrew University (Israel). „Unsere Analyse zeigte, dass soziale Unterstützung ein wichtiger Faktor war. Unter denjenigen, die Gewalt bei den Eltern erlebt hatten, hatten diejenigen, die mehr soziale Unterstützung hatten, viel höhere Chancen, als Erwachsene eine ausgezeichnete psychische Gesundheit zu besitzen.“
Quelle: www.kinderaerzte-im-netz.de vom 15.07.2022
Sucht und Drogen: Mindestpreis für Alkohol und legalisiertes Cannabis
Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) fordert eine Verteuerung von Alkohol und eine Legalisierung von Cannabis. Beides sollte zudem nur noch in lizenzierten Geschäften abgegeben werden dürfen, so die Kammer. Zugleich empfiehlt sie ein Mindestalter von 18 Jahren für den Kauf aller legalen Drogen. Die Abgabe an Minderjährige müsse stärker als bislang sanktioniert werden.
Die Drogenpolitik könne den Gebrauch von Drogen nicht verhindern, konstatiert Kammerpräsident Dr. rer. nat. Dietrich Munz. „Deshalb sollten Erwachsene wie Jugendliche lernen, Drogen so zu nutzen, dass sie ihre Gesundheit nicht gefährden und das Risiko für Missbrauch und Abhängigkeit gering bleibt.“
Bei der Beschränkung aller legalen Drogen auf Lizenzshops schwebt der BPtK eine „Abgabe durch Fachpersonal“ vor, ausgebildet in Suchtprävention. Künftig solle das Fachpersonal über die Wirkungen informieren und das Alter prüfen. „Alkohol ist deutlich gefährlicher als Cannabis“, stellt die BPtK fest. Denn die legale Droge könne tödlich sein. Cannabis gelte dagegen als moderat schädliche Droge. Cannabis sei jedoch nicht harmlos und berge insbesondere das Risiko von Psychosen, konstatiert die BPtK. Doch der Gebrauch von Cannabis nehme trotz Verbots seit Jahrzehnten zu.
Die Stellungnahme kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Koalition eine kontrollierte Cannabisfreigabe vorbereitet. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will bis zum Herbst Eckpunkte für die geplante Cannabisfreigabe vorlegen.
Quelle: www.aerzteblatt.de/ Ausgabe Juli 2022
Transgenderversorgung: Universitätsklinikum Münster eröffnet interdisziplinäres Zentrum
Mit dem Ziel, Transpersonen eine ganzheitliche, lebensbegleitende Versorgung zu ermöglichen, wurde am Universitätsklinikum Münster (UKM) Deutschlands erstes interdisziplinäres Kompetenzzentrum Center for Transgender Health (CTH) eingerichtet.
„Durch die Bündelung und Vernetzung aller an der Behandlung von Transpersonen beteiligten medizinischen Disziplinen, sollen Versorgung und Forschung in der Transgesundheit entscheidend vorangebracht werden“, sagte Prof. Dr. med. Georg Romer, erster Sprecher des CTH. Er vertritt als Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie mit seinem Team behandlerisch auch den psychosozialen Schwerpunkt der Transition.
Im Kindes- und Jugendalter seien Gefühle der Verunsicherung im Hinblick auf die geschlechtliche Identität nicht selten und können auch vorübergehend sein, so Romer. „Ist jedoch der Wunsch nach Behandlung einer Geschlechtsdysphorie, also dem Leiden am angeborenen Geschlecht, vorhanden, tritt er oft schon in früher Jugend auf.“ Es sei wichtig, Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern in dieser frühen Phase psychiatrisch beratend eng und ergebnisoffen zu begleiten. „Erst wenn in unserer Spezialambulanz der finale Entschluss einer Geschlechtstransition geäußert wird, kommen die weiteren Disziplinen des Kompetenzzentrums ins Spiel.“
Das CTH biete ein ganzheitliches und lebenslanges Konzept vom Wunsch nach Transition über die psychosoziale Beratung, Hormonbehandlung, Stimmtherapie bis hin zum chirurgischen Eingriff der geschlechtsangleichenden Operation, erläuterte Romer. Auf Wunsch würden Transpersonen auch hinsichtlich des Erhalts der Möglichkeit einer späteren Elternschaft beraten.
Quelle: www.aerzteblatt.de; Ausgabe Juli 2022
Sommerpause!!!
Die Praxis ist vom 18. Juli bis zum 03.08.2022 geschlossen.
Bei Notfällen: siehe Notfallkontakte
Ich wünsche allen entspannte und schöne Sommertage!
BZgA stellt Informationen zu Long-COVID für Betroffene bereit
Hilfreiche Informationen rund um das Thema Long-COVID finden Interessierte ab sofort unter www.longcovid-info.de. Die neue Webseite verweist zudem auf wichtige Anlaufstellen, zum Beispiel auf Hilfs- und Beratungsangebote.
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hat das Long-COVID-Informationsportal in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und 13 weiteren Organisationen aus dem Gesundheitswesen, der Arbeitswelt und der Wissenschaft erstellt. Auch die KBV ist an dem Projekt beteiligt.
Die Webseite bietet neben allgemeinen Infos zu Long-COVID unter anderem Informationen zu Behandlungsmöglichkeiten und Unterstützungsangeboten für Betroffene und Angehörige. Zudem werden verschiedene Reha-Angebote erläutert. Unter dem Menüpunkt „Materialien“ stehen verschiedene Infografiken, beispielsweise zu häufigen Krankheitszeichen, zum Download bereit.
Quelle: KVWL vom 13.06.2022
